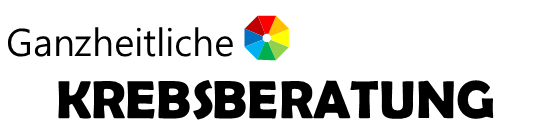Gibt es eine Krebspersönlichkeit?
In der Vorstellung vieler Schulmediziner ist Krebs ein rein körperliches Problem und hat mit der Psyche nichts zu tun. Ursachen sind genetisch bedingt oder reiner Zufall und Krebs könne jeden treffen. Eine Krebspersönlichkeit gäbe es nicht.
Womit sie Recht haben, ist der Punkt, dass man Menschen, die an Krebs erkranken, sicherlich nicht alle in eine Schublade stecken kann. Jeder Mensch und jede Lebensgeschichte ist einzigartig und auch beim Krebs gibt es viele Arten und Differenzierungen.
Dennoch wird jeder, der sich mit der Psyche von Menschen mit Krebs tiefergehend beschäftigt – was Schulmediziner in der Regel nicht tun, weil sie dafür weder die Zeit noch die Ausbildung haben und meist wahrscheinlich auch gar nicht das Interesse – ziemlich rasch feststellen, dass es auffällige Gemeinsamkeiten gibt. Dies gilt sowohl für die Persönlichkeit als auch für die Familiengeschichte, die das psychoenergetische Muster der Person geprägt hat.
Das Familienfeld und psychosoziale Vererbung
In der psychologischen Fachwelt spricht man auch vom Familienfeld oder dem morphogenetischen Feld der Familie. Es geht dabei um Verhaltens- und Denkmuster, Gefühle und Erfahrungen, die sich über Generationen durchziehen und wiederholen. So kann auch die Tatsache, dass bestimmte Krebsarten in einer Familie gehäuft vorkommen, durchaus nicht nur mit genetischer Veranlagung erklärt werden, sondern mit diesem Familienfeld. Krebs wird nicht in erster Linie biologisch, sondern vor allem psychosozial vererbt.
Forschungen zum Thema Psyche und Krebs gibt es zahlreiche. Interessant ist, dass diese unabhängig voneinander zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Zu erwähnen seien hier z.B. die Arbeit des amerikanischen Psychoanalytikers Dr. Lawrence LeShan*, die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten von Dr. phil. Dr. med. sc. Ronald Grossarth-Maticek*² an der Universität Heidelberg und die Erfahrungen von Bernd Joschko mit der von ihm entwickelten Methode der Psychobionik (ursprünglich Synergetik). Alle drei haben in ihrer jahrzehntelangen Arbeit große Erfolge erzielt.
Psychische Gemeinsamkeiten bei Frauen mit Brustkrebs – eigene Beobachtungen
Ich selbst habe mich beim Reflektieren meiner eigenen Fälle in der ganzheitlichen Krebsberatung auf Brustkrebs konzentriert, da das die häufigste Krebsart ist, mit der ich in der Beratung zu tun habe und weil dort die Ergebnisse für mich auch am augenscheinlichsten sind. Das bedeutet nicht, dass nicht auch bei anderen Krebsarten die Psyche eine große Rolle spielt, aber die Themen mögen sich im Detail unterscheiden.
Obwohl meine eigenen Erfahrungen noch sehr bescheiden sind – ich greife hier lediglich auf 13 Anamnesegespräche mit von Brustkrebs betroffenen Frauen zurück – ziehen sich einige Themen in auffälliger Weise durch. Und sie decken sich auch mit den Forschungen in der einschlägigen Literatur. Ich möchte diese nun kurz darstellen:
Immer für andere da sein
Frauen, die Brustkrebs bekommen, sind in der Regel liebenswerte Menschen. Sie sind immer für andere da, übernehmen Verantwortung dafür, dass sich alle wohl fühlen und die Harmonie gewahrt bleibt. Oft übernehmen sie aus Pflichtbewusstsein heraus Aufgaben, die für sie mühsam und anstrengend sind und ihnen keinen Spaß machen, für die sie aber kaum Dank und Anerkennung erhalten, z.B. die Pflege naher Angehöriger, mit denen sie womöglich auch noch ein konfliktbelastetes Verhältnis haben.
Was will ich eigentlich selbst?
Manchmal sind sie so sehr damit beschäftigt, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, dass sie die eigenen gar nicht wahrnehmen. Sie wissen selbst nicht, was ihnen eigentlich Spaß macht, was sie gerne tun würden. Und wenn sie es wissen, gestehen sie sich nicht zu, ihre Bedürfnisse auch zu erfüllen.
Dahinter stehen meistens ein hohes Harmoniebedürfnis und die Angst, nicht mehr geliebt zu werden, wenn sie eigene Ansprüche stellen und nicht immer für andere da sind. So leben sie nicht das eigene Leben, sondern machen das, was andere von ihnen erwarten.
Trauer und Verlassenheit
Auffallend häufig berichten Frauen mit Brustkrebs, dass sie schon in der Kindheit ein Grundgefühl von Trauer und Verlassenheit hatten. Die Gründe dafür können verschieden sein.
Entweder hatten die Eltern wenig Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, z.B. weil sie viel arbeiteten und die Arbeit immer vorging, oder sie wuchsen in einem rigiden Elternhaus auf, in dem sie ihre kindlichen Bedürfnisse nicht ausleben konnten oder durften. Es kann auch sein, dass ein Elternteil früh gestorben ist und der andere mit seiner eigenen Trauer beschäftigt war und deshalb nicht auf das Kind eingehen konnte. Eine ähnliche Situation ergibt sich beim frühen Tod eines Geschwisterkinds.
Ständig angespannt und auf der Hut
Oder sie mussten ständig wachsam und auf der Hut sein, weil es viele Konflikte zwischen den Eltern gab, ein Elternteil Alkoholiker war oder Gewalt ausübte, so dass es für sie überlebenswichtig schien, Vater oder Mutter bei Laune zu halten, zu trösten oder zwischen Familienmitgliedern zu vermitteln. Die kindliche Verspieltheit und Ausgelassenheit blieben dabei auf der Strecke.
Das ungewollte Kind
Bei Brustkrebs links (weibliche Seite) ist es vor allem die Mutter, die abwesend ist und ihre mütterliche Aufgabe nicht erfüllen kann, entweder weil sie früh stirbt oder emotional dazu nicht in der Lage ist. Es kann sein, dass sie das Kind gar nicht wollte. Das ungewollte Kind versucht dann, möglichst brav zu sein und der Mutter möglichst wenig Mühe zu machen. Und im Unterbewusstsein setzt sich die Botschaft fest, dass es eigentlich gar kein Recht zu leben hat.
Aber auch wenn die Mutter zu einem späteren Zeitpunkt ihre Tochter nicht unterstützt, sondern sich gegen sie stellt, kann das enorm kränkend, also krank machend sein.
Todessehnsucht
Daraus resultiert dann manchmal eine Todessehnsucht, oft schon in der Kindheit oder Jugend. Aus systemischen Familienaufstellungen weiß man, dass Kinder oft unbewusst einem früh gestorbenen Familienmitglied nachfolgen wollen. Vor allem dann, wenn über dieses Thema nicht gesprochen und der verstorbenen Person kein Platz im Familiensystem eingeräumt wird.
Auch Frauen, die den Begriff „Todessehnsucht“ nicht wörtlich in den Mund nehmen, berichten häufig, dass sie keinen starken Lebenswillen haben, gleichzeitig aber auch, dass sie noch gar nicht gelebt hätten. An diesem Punkt stehen sie nun vor der Entscheidung, die Krebserkrankung als Ticket zu benutzen, um dieser Todessehnsucht zu folgen, oder endlich den Mut aufzubringen, das Leben zu leben, das ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. Freudig, erfüllt und lebendig.
Der fehlende Vater
Wenn der Vater nicht als Vater zu Verfügung steht, ist das eigentlich ein Thema für Brustkrebs rechts, da die rechte Seite die Vater- und Partnerseite ist. In meinen eigenen Aufzeichnungen kam das allerdings bei Brustkrebs links noch häufiger vor. Der Vater kann dabei entweder tatsächlich nicht vorhanden sein, z.B. bei einer frühen Trennung der Eltern, wenn er sich nicht für die Tochter interessierte oder der Kontakt von der Mutter unterbunden wurde. Oder er erfüllt seine Rolle als unterstützender und beschützender Vater nicht. Etwa, weil er aus beruflichen Gründen viel abwesend, gewalttätig, suchtkrank oder einfach emotional schwach ist.
Sorge um die Kinder
Da der Vater üblicherweise das unbewusste Urbild für die Partnerwahl der Tochter ist, setzen sich die Vaterthemen oft in der Partnerschaft fort. Wenn der Vater seine Rolle als Vater nicht richtig erfüllt hat, suchen sich Frauen oft Partner, die ebenfalls ihre Vaterrolle gegenüber den Kindern nicht erfüllen. Die Frauen haben dann nicht die Unterstützung in der Erziehung ihrer Kinder, die sie sich wünschen oder müssen gar die Kinder vor dem Vater schützen, wenn er ihnen gegenüber Gewalt ausübt.
Selbst wenn der Partner – objektiv gesehen – kein schlechter Vater ist, kann die Frau das in der Kindheit erlernte Gefühl, ständig die Kontrolle behalten zu müssen, nicht ablegen, weil die Angst, dass er etwas falsch macht, tief in ihr sitzt und sie dem Partner nicht zutraut, die Kinder gut zu betreuen.
… auch wenn sie erwachsen sind
Ein weiteres häufiges Thema sind Kinder, die den betroffenen Frauen und Müttern auch im Erwachsenenalter noch große Sorgen machen. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn ein Kind eine Beeinträchtigung hat, die es ihm nicht ermöglicht, ein selbstständiges Leben zu führen oder wenn es sein Leben nicht im Griff hat, süchtig oder psychisch krank ist oder andere gravierende Probleme hat, so dass die Mutter es nicht guten Gewissens loslassen kann.
Trennungskonflikte und schwierige Beziehungen
Schwierige und sehr stressreiche Paarbeziehungen sind bei Frauen mit Brustkrebs häufig anzutreffen. Und sich über lange Zeit hinziehende Trennungskonflikte gehen einer Krebserkrankung oft voraus. Auch dieses Thema kann über Generationen weitergegeben werden. So berichtete etwa eine meiner Klientinnen, dass in ihrer Familie Frauen über drei Generationen hinweg Beziehungen führten, in denen das Trennungsthema ständig im Raum stand, obwohl es eigentlich mehr Verbindendes als Trennendes gab.
Besonders kränkend (krank machend) ist es, wenn der Partner die betroffene Frau ständig herabsetzt und sie seinen Sticheleien ausgesetzt ist.
Oft ist die aktuelle oder gerade beendete Beziehung auch nicht die erste, sondern die betroffene Frau hat schon mehrere schwierige Beziehungen und Scheidungen oder Trennungen hinter sich.
Sexuelle Gewalt
Sexuelle Gewalt spielte in meinen bisherigen Beratungen eine geringe Rolle. Das liegt aber vermutlich nicht daran, dass es sie nicht gibt, sondern dass es sich dabei um ein Tabuthema handelt, das meistens nicht schon beim Anamnesegespräch zur Sprache kommt. Es kann auch sein, dass diese Erfahrungen, wenn sie in der Kindheit liegen, so gut verdrängt sind, dass sie der betroffenen Frau gar nicht bewusst sind und erst bei tiefergehender Arbeit zum Vorschein gekommen wären. Aus anderen Kontexten und vor allem aus den Erfahrungen, die mit der Psychobionik gemacht wurden, weiß ich, dass sexuelle Gewalt sehr wohl ein wichtiger ursächlicher Faktor bei Brustkrebs sein kann.
Beruflicher Stress und ungeliebte Arbeit
Nicht nur die Familie, auch die berufliche Arbeit kann bei Brustkrebs eine Rolle spielen. Einerseits geht ein hoher Stresslevel, der auch mit der beruflichen Tätigkeit verbunden sein kann, sehr oft einer Krebserkrankung voraus, was allein schon dadurch erklärt werden kann, dass Stress das Immunsystem schwächt und sich Zellen bei Dauerstress nicht regenerieren können.
Andererseits kann das Vater- oder Mutterthema auch auf Vorgesetzte projiziert werden. Und eine ungeliebte Arbeit, die den eigenen Träumen und Begabungen nicht entspricht, ist, wie schon am Anfang erwähnt, sehr typisch für Brustkrebs und für Krebs allgemein.
In Familienunternehmen sind die Bereiche Familie und Beruf besonders stark miteinander verquickt. Wenn Vater oder Mutter, die ein Unternehmen aufgebaut oder schon von ihren Eltern übernommen haben, von einem Kind erwarten, in ihre Fußstapfen zu treten, ist es für das Kind noch schwieriger, sich den Wünschen der Eltern zu widersetzen und seinen eigenen Weg zu gehen als in anderen Fällen.
Risikofaktoren wirken synergistisch zusammen
Die eine oder andere geschilderte Situation oder Verhaltensweise bzw. die genannten Konflikte kennen natürlich viele Menschen. Und wenn Sie (noch) keinen Krebs haben und sich in meiner Schilderung der Themen, die bei Brustkrebs häufig vorkommen, wiederfinden, bedeutet das nicht, dass Sie nun Krebs bekommen werden. Bernd Joschko hat in seiner 40-jährigen Erfahrung mit Tausenden von Sessions festgestellt, dass immer 5 – 8 Faktoren, die synergistisch zusammenwirken, sich also gegenseitig bestärken und potenzieren, notwendig sind, damit Krebs entstehen kann.
Auch Grossarth-Maticek stellte fest, dass ein Risikofaktor allein die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, nur geringfügig erhöht. Wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, addieren diese sich jedoch nicht, sondern sie multiplizieren sich. 5 Risikofaktoren machen eine Krebsentstehung also um ein Vielfaches wahrscheinlicher als nur einer oder zwei.
Psychische Krebsprophylaxe
Die gute Nachricht ist: Psychoenergetische Muster sind veränderbar. Sowohl neurowissenschaftliche Forschungen als auch die Praxis von Krebstherapeuten zeigen, dass sich Neuronen im Gehirn neu verknüpfen können, und zwar unabhängig vom Alter. Wir können also nicht nur unser gegenwärtiges Denken, Fühlen und Verhalten ändern, sondern auch die abgespeicherten Bilder und Gefühle in unserem Unterbewusstsein.
Die Forschungen von Grossarth-Maticek ergaben, dass es sogar möglich ist, durch prophylaktische psychotherapeutische Interventionen das Risiko, an Krebs zu erkranken, signifikant zu verringern.
Selbstregulationsfähigkeit ist der Schlüssel
Er wählte für seine Forschungen Menschen aus, die – aufgrund der Ergebnisse aus anderen Forschungen – ein sehr hohes Risiko hatten, an Krebs zu erkranken und teilte sie in zwei vergleichbare Gruppen. Mit einer Gruppe wurde daran gearbeitet, die Selbstregulationsfähigkeit zu erhöhen, also die Fähigkeit, selbstverantwortlich sein Leben zu gestalten, anstatt sein Glück oder Unglück von anderen Menschen oder Umständen abhängig zu machen. Mit der Kontrollgruppe wurde nicht gearbeitet. Es zeigte sich, dass die Menschen, die ihre Selbstregulationsfähigkeit erhöhen konnten, wesentlich seltener Krebs bekamen als die andere Gruppe. Und sie entwickelten auch seltener andere schwere Erkrankungen.
Nicht alles ändern, aber das, was krank macht
Die zweite gute Nachricht ist: Dazu ist keine jahrelange Psychoanalyse notwendig. Es reichten oft einige wenige Gespräche. Noch tiefgründiger ist Innenweltsurfen®, das ich Ihnen auch anbieten kann.
Es genügt allerdings nicht, nur die vergangenen Traumata im Unterbewusstsein aufzulösen. Die neuen inneren Bilder müssen auch in den Alltag integriert werden, was konkrete Veränderungen im gegenwärtigen Leben notwendig machen kann. Dabei muss nicht unbedingt das ganze Leben umgekrempelt werden. Was gut ist, soll bleiben. Geändert werden muss das, was zur Krankheitsentstehung beigetragen hat. Wenn das passiert, sind die Chancen hoch, eine bestehende Krebserkrankung zu überwinden oder das Erkrankungsrisiko deutlich zu verringern.
Im Gesundheitscoaching arbeite ich mit Ihnen an diesem Ziel.
*Lawrence LeShan: Diagnose Krebs: Wendepunkt und Neubeginn, Klett-Cotta
*²Helm Stierling, Ronald Grossarth-Maticek: Krebsrisiken – Überlebenschancen. Wie Körper, Seele und soziale Umwelt zusammenwirken, Carl-Auer